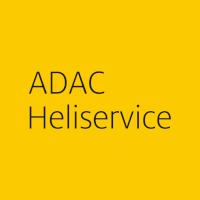Es gibt Momente, für die lohnt sich das frühe Aufstehen, so lang der Abend am Tag zuvor auch gewesen sein mag. Das wissen insbesondere jene Piloten, die ihre Messungen in möglichst ruhiger Luft absolvieren müssen, die es so nur am frühen Morgen gibt, kurz nach Sonnenaufgang. Und so hält sich der Unmut über um vier Uhr morgens klingelnde Wecker bei den Crews der Messflugzeuge und Schleppmaschinen in Grenzen, wenn es heißt, die Flugzeuge auszuhallen, Vorflugkontrollen abzuarbeiten, die Messtechnik hochzufahren und dann noch gut einen Kilometer Rollweg bis zum Start hinter sich zu bringen. Wenn dann bei Sonnenaufgang die Motoren aufheulen, ein Messverband den Boden verlässt und die sanft über den Horizont greifenden ersten Sonnenstrahlen durchbrechen, entschädigt das für alle Strapazen. Die leuchtenden Augen der Crews nach der Landung zeugen davon.
Etliche solcher Sunrise-Flüge gab es auch beim diesjährigen Sommertreffen der Interessengemeinschaft der akademischen Fliegergruppen, kurz Idaflieg, die zum vierten Mal auf dem Flugplatz Stendal für drei Wochen zusammenkamen – drei Wochen im Zeichen der Wissenschaft. Und vor allem die Ergebnisse der Flugleistungsvermessungen am frühen Morgen sind es, die am Ende in der Segelflug-Community in der Breite diskutiert werden. Denn hier müssen neue Muster unter Beweis stellen, ob sie die Herstellerangaben in Bezug auf Gleitzahl, Sinkgeschwindigkeit und andere Parameter erfüllen. Eine Art Stunde der Wahrheit. In diesem Jahr musste sich unter anderem die DG-1001 mit Neo-Winglets dem Vergleich mit dem Discus 2c des DLR stellen. Der ist bereits exakt vermessen und dient als Referenzflugzeug, das über ein Differenz-GPS Rückschlüsse auf die Flugleistungen anderer, parallel dazu geflogener Muster zulässt.

Mit Stoppuhr und Winkelmesser
Aber auch für andere Untersuchungen braucht es Luftmassen, die möglichst stabil und ohne Einfluss von Wind und Thermik sind, beispielsweise für das statische Zachern von Segelflugzeugen, also der Flugeigenschaftsbestimmung mit Maßband, speziellem Winkelmesser, Federkraftmesser und Stoppuhr. Diese von Hans Zacher entwickelte Methode ist bis heute für Piloten der Akafliegs der Einstieg ins wissenschaftliche Fliegen, verlangt sie doch nach präziser Flugzeugbeherrschung, um valide Ergebnisse zu erzeugen. Aus dem reichen Datenschatz einer Vielzahl von Zacherprotokollen lassen sich so zuverlässig Rückschlüsse auf das Handling der gezacherten Muster ziehen. Neben der Flugleistungsvermessung und den Zacherflügen gehören sogenannte Sondermessprojekte zu den Fixpunkten des Sommertreffens. Hier reicht die Bandbreite von Tests einzelner Komponenten wie Winglets oder Leitwerksauslegungen über die Untersuchung spezifischer Eigenheiten wie Lärmemissionen bis hin zu kompletten Flugtestkampagnen, in denen Eigenentwicklungen der Akafliegs vom Erstflug bis zur finalen Zulassung erprobt werden.
Letzteres sollte mit der B12 der Akaflieg Berlin gelingen, einem Doppelsitzer mit 18,20 Metern Spannweite, der in den fast 40 Jahren seit seinem Erstflug immer wieder konstruktive Änderungen erfuhr. Jetzt wähnen sich die Berliner auf der Zielgeraden, beim Sommertreffen wurden noch zahlreiche Messflüge dafür durchgeführt. Deutlich neueren Datums sind die fs33 Gavilán und die fs35 Harpyie der Akaflieg Stuttgart, erstere ein 20-Meter-Doppelsitzer, zweitere ein mit Fokus auf den Schleppbetrieb konzipierter Motorsegler mit Dieselmotor. Beide absolvierten ebenfalls Erprobungsflüge. Bei der fs33 stand vor allem die Flattererprobung im Fokus, die zunächst bis 280 Kilometer pro Stunde, später über die projektierte Höchstgeschwindigkeit hinaus bis 290 und 308 Kilometer pro Stunde getestet wurde. Die fs35 hingegen hatte ihre bereits bei der Deutschen Segelkunstflugmeisterschaft hoch gelobte Schlepptauglichkeit noch einmal bei wissenschaftlichen Messflügen unter Beweis zu stellen.
"Top Gun"-Feeling brachte die Flugtechnische Arbeitsgemeinschaft Esslingen mit in die Altmark. Jüngst übernahm die Gruppe mit dem Apis-Jet ein besonderes Fluggerät, das von Professor Ulrich Gärtner und Ingenieur Clemens Harr an der Hochschule Esslingen entwickelt wurde. Dabei integrierten sie ein Jettriebwerk in den Rumpf einer Pipistrel Apis. Langfristiges Ziel der Esslinger ist es, den Apis-Jet zur Einzelstückzulassung als Motorsegler zu bringen und in den Flugzeugpark der FTAG einzugliedern, um damit Erfahrungen zu sammeln, beispielsweise auch beim Betrieb des Triebwerks mit nachhaltigen Kraftstoffen. In Stendal wurden unter anderem Flüge zur Fahrtmesserkalibrierung und zur Flattersicherheit absolviert, mit dem Ergebnis, dass die Höchstgeschwindigkeit von 170 auf 200 Kilometer pro Stunde erhöht werden konnte.
Dass es bei den Akaflieg-Konstruktionen nicht immer in die Luft gehen muss, beweist das Projekt E16, das ebenfalls von der FTAG Esslingen betreut wird. Auf Basis eines Doppelsitzerrumpfes haben die Studenten ein Transportfahrzeug mit vollelektrischem Antrieb konstruiert. Aktuell noch mit klassischen Bleibatterien ausgestattet und mit der ein oder anderen Kinderkrankheit geschlagen, soll die E16 perspektivisch eine CO2-neutrale Rückholung von Flugzeugen ermöglichen. Die FTAG will dabei vor allem Erfahrungen bei der Auslegung von elektrischen Antrieben, Batteriemanagementsystemen und Regeltechnik sammeln.
Ein weiteres Projekt, an dem der aerokurier nicht ganz unschuldig ist, konnte zumindest begonnen werden: der Vergleich von stark motorisierten ULs und klassischen Schleppmaschinen der E-Klasse in Bezug auf ihre Leistung im F-Schlepp. Dafür waren eine WT-9 Dynamic und eine Breezer B850 nach Stendal gekommen, mit denen erste Test-flüge absolviert werden konnten. Aufgrund der immer wieder aufkommenden Diskussion in der Segelflugszene, ob die Zeiten von Remo, Husky und Co angesichts der Schleppleistungen moderner ULs mit weniger als dem halben Verbrauch zu Ende gehen, scheint eine faktenbasierte Antwort auf diese Frage überfällig.
Schließlich verdienen noch weitere wissenschaftliche Projekte, hier erwähnt zu werden. Das digitale Zachern beispielsweise, bei dem ein auf dem Höhenleitwerk montierter Pod, der mit Fünflochsonde und weiteren Sensoren ausgestattet ist, verschiedene Parameter des Fluges aufzeichnet, die dann mit den von den Zacher-Piloten manuell erfassten Daten abgeglichen werden können. Ulrich Deck vom Institut für Aerodynamik und Gasdynamik der Universität Stuttgart untersuchte mit einem aufwendigen Messsystem die Auswirkungen von Turbulenzen auf die Leistung von Flügelprofilen. Dazu absolvierte er mehrere Flüge mit einem Ventus 3, der an seiner linken Tragfläche einen Pod mit Fünflochsonde, Nachlaufrechen zur Bestimmung des Profilwiderstandes und Heißfilmsensoren für die Analyse der Strömungsverhältnisse auf der Flügeloberseite mitführte. Die Untersuchungen, die sowohl bei ruhiger Luft als auch in der Thermik durchgeführt wurden, sollen zeigen, wie sich die Profile außerhalb der optimalen Bedingungen in einem Windkanal verhalten.

Positives Fazit zum Abschluss
Der Idaflieg-Vorstand zog gegen Ende des Sommerstreffens eine durchaus zufriedene Bilanz: "Wir hatten drei Wochen top Wetter und konnten an fast allen Tagen fliegen", resümiert Katharina Diehn, Präsidentin der Idaflieg. Die 100 Studierenden, von denen im Peak bis zu 70 gleichzeitig vor Ort gewesen seien, hätten gut 800 Flüge mit insgesamt mehr als 870 Stunden absolviert. 30 Zacherprotokolle seien in Stendal fertiggestellt, 25 Starts zur Flugleistungsmessung durchgeführt und zahlreiche Sondermessprojekte begonnen, fortgeführt und abgeschlossen worden. "Damit können wir absolut zufrieden sein. Vor allem: Alles ist unfallfrei abgelaufen." Auch in diesem Jahr bedankt sich der Idaflieg-Vorstand im Namen aller Teilnehmer für die Unterstützung durch das DLR, das LBA und den Flugplatz Stendal, die den Studierenden den Rücken freihalten für ihre Forschungsarbeit.