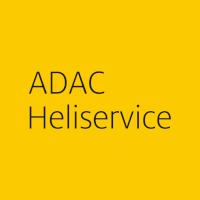Viel Aufmerksamkeit bekommen sie meist nicht: Ein flüchtiger Blick, ein liebloses Rütteln, eine gedankenlose Funktionsprüfung – das ist ungefähr das Maximum an Zuwendung, das die Landeklappen bei der Vorflugkontrolle erwarten dürfen. Dabei sind die beweglichen Teile an den Flügelhinterkanten wahre Aerodynamikkünstler, die sehr unterschiedliche Aufgaben souverän miteinander verbinden. Beim Start zum Beispiel sorgen sie dafür, dass sich die Flugfähigkeit früher einstellt. Bei der Landung ermöglichen sie einen steileren Anflug, ohne dass sich zusätzliche Fahrt aufbaut.

Selbst beim Manövrieren in der Luft erweisen sich die Klappen als loyale Unterstützer. In ausgefahrenem Zustand lassen sich mit ihrer Hilfe aufgrund der niedrigeren Mindestgeschwindigkeit engere Kurvenradien erzielen. Die neue Tecnam P2006T beispielsweise verlangt 71 Knoten, wenn sie mit 30 Grad Querlage in die Kurve geht. Hat der Pilot aber vorher die Klappen auf 40 Grad gesetzt, reichen der Zweimot moderate 58 Knoten, um nicht vom Himmel zu fallen. Die Konstrukteure haben daher sehr viel Gedankenarbeit darauf verwendet, wie die Klappe aussehen sollte, und mehrere Typen erfunden, die sich im Aufbau teilweise stark unterscheiden. Fatal wäre ein asymmetrisches Ausfahren, verhindert wird es durch mechanische Vorkehrungen. Weit verbreitet ist die Wölbklappe, die zum Beispiel bei der Robin DR400, der DA40 von Diamond und der Piper PA-28 zu finden ist.
Dieser Typ ist eine eher simple Lösung: Ein großer Teil der Flügelhinterkante ist hier als Klappe ausgebildet, die sich bei Bedarf in mehreren Stufen absenken lässt. Die Bedienung erfolgt entweder elektrisch oder ganz rustikal mit einem Hebel. Das Ziel ist klar: Die Wölbung des Flügels vergrößert sich. Die größere Wölbung hat mehr Auftrieb zur Folge, ohne dass sich erheblich mehr Widerstand ergibt oder ein heftiges Nicken ausgelöst wird. Die Tiefe einer Wölbklappe variiert, sie kann unter 15 Prozent, aber auch über 25 Prozent betragen. Je kleiner die Tiefe, desto größer muss der maximale Klappenausschlag sein. Eine im Verhältnis schmale Klappe kann allerdings nur ein eher bescheidenes Auftriebsplus beisteuern. Allen Klappentypen gemeinsam ist, dass sie in ausgefahrenem bzw. abgesenktem Zustand für einen höheren Luftwiderstand verantwortlich sind. Dies gilt besonders für Klappen in der 50-Grad-Stellung. Darüber hinaus verursachen sie beim Aus- und Einfahren Nickmomente, die mitunter recht kräftig ausfallen. Schuld daran ist der Auftriebsschwerpunkt. Er zieht sich beim Ausfahren weiter nach hinten zurück, was zur Folge hat, dass das Flugzeug die Nase nach unten nimmt.
Beim Einfahren ist es umgekehrt. Viele Piloten gehen routinemäßig mit teilweise ausgefahrenen bzw. abgesenkten Klappen an den Start. In dieser Situation produzieren die Klappen zusätzlichen Auftrieb, und das bleibt nicht ohne günstigen Einfluss auf die Startrollstrecke. Allerdings handelt man sich auch mehr Widerstand ein, was zu Lasten der Steigdistanz geht. Das Ergebnis ist eine, gegenüber dem Start mit ungenutzten Klappen, kürzere Startrollstrecke bei schlechterer Steigleistung. Zu große Klappenwinkel würden diesen Vorteil aber wieder zunichtemachen. Das vielfach bewährte Prinzip „Je mehr, desto besser“ gilt hier auf keinen Fall. Wenn eine Baumreihe in der Verlängerung der Piste darauf wartet, das gerade gestartete Flugzeug in Empfang zu nehmen, ist eine Rechenaufgabe angesagt: Reicht die Bahnlänge, um die Hindernisse sicher zu überfliegen? In die Kalkulation müssen natürlich die relevanten variablen Faktoren wie das aktuelle Abfluggewicht, der Wind und die Pistenbeschaffenheit eingehen. Das Flughandbuch sagt im Abschnitt „Flugleistungen“, wie es geht.
Zurücksetzen der Klappen im Steigflug

Haben die Klappen ihren Job wie gewohnt erledigt, werden sie bald wieder zurückgesetzt. Aber erst dann, wenn genug Luft unter dem Kiel ist. Auch während einer Richtungsänderung im Steigflug ist das Einfahren der Klappen zulässig (sofern im Flughandbuch nichts Gegenteiliges steht). Der Pilot muss jedoch auf einen gewissen Auftriebsverlust und ein Nickmoment gefasst sein. In der Fliegerkneipe trifft man manchmal auf selbst ernannte Experten, die bei Starts auf kurzen Pisten zu folgender Methode raten: Ohne Flügelklappen anrollen, um schneller zu beschleunigen, Flügelklappen erst bei der Abhebegeschwindigkeit auf Klappenstufe eins ausfahren. Diese Kurzstarttechnik birgt aber Risiken: Die Aufmerksamkeit des Piloten wird in dieser prekären Flugphase durch die Klappenbedienung abgelenkt. Im Falle eines Startabbruchs kann sich dadurch die Reaktionszeit verlängern. Das Ausfahren der Klappen während des Startlaufs erzeugt zudem eine starke Aufbäumtendenz, die sicher beherrscht werden muss.

Auch das Einfahren der Flügelklappen unmittelbar nach dem Start, um die Steigrate zu verbessern, ist riskant. Der beim Einfahren geringer werdende Auftrieb muss durch höhere Geschwindigkeit ausgeglichen werden. Diese Vorgehensweise verlängert die Startsteigstrecke. Zugleich muss die sich unweigerlich einstellende Lastigkeitsänderung mit dem Höhensteuer oder durch Nachtrimmen wieder ins Lot gebracht werden. All das spielt sich nah am Erdboden und unter Zeitdruck ab. Ein falscher Griff in der Hektik oder eine falsche Einschätzung der Geschwindigkeiten kann schnell zu einem vorzeitigen Ende des Fluges im Flugplatzzaun führen. Bei der Landung spielen die Klappen ihre Stärken voll aus. Das übliche Verfahren sieht ein stufenweises Ausfahren bzw. Absenken vor. Auf diese Weise lassen sich Geschwindigkeit, Bahnneigung und Sinkrate feinfühlig kontrollieren, der Anflug wird insgesamt ruhiger. Einige Piloten propagieren die Methode „Hochran an den Platz – Klappen voll raus und runter“. Im Einzelfall ist das richtig, nicht aber generell. Vielmehr müssen der Zeitpunkt zum Ausfahren und die zu wählende Klappenstufe stets aufs Neue auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmt werden. Ein ewiges Diskussionsthema ist die Klappenbetätigung in der Endanflugkurve. So lange im Flughandbuch nichts anderes steht, dürfen Flügelklappen auch in der Kurve ausgefahren werden.
Ist der Anflug stabil und die Landung erscheint sichergestellt, kann bei Bedarf noch die höchstzulässige Stufe gewählt werden. Wegen der größeren Bremswirkung muss mit erhöhter Motorleistung ausgeglichen werden. Die auftretenden Steuerkräfte werden weggetrimmt. Zuweilen ist auf unseren Verkehrslandeplätzen Folgendes zu beobachten: Kaum haben die Räder den Boden berührt, verschwinden die Klappen. Für das Einfahren unmittelbar nach dem Aufsetzen spricht die größere Bodenhaftung der Reifen. Die Nachteile überwiegen aber. Auch ein voll gezogenes Höhensteuer verkürzt die Ausrollstrecke. Das Hauptaugenmerk sollte darauf und auf dem Bremseinsatz liegen. So umgeht man auch die Gefahr, aus Versehen zum Fahrwerkshebel zu greifen (wie schon vorgekommen).
Klappen bei Seitenwind

Kräftiger Seitenwind ist bei der Wahl der Klappenstellung zu berücksichtigen. Voll ausgefahrene Klappen bieten dem Wind eine beachtliche Angriffsfläche. Die Seite des Flugzeugs, die dem Wind zugewandt ist, wird naturgemäß stärker beeinflusst. Dadurch verstärkt sich die Tendenz des Flugzeugs, in den Wind zu drehen. Je näher der Boden kommt, umso größer wird die Auswirkung des Klappenwinkels im Bodeneffekt. Daher kann es bei starkem Seitenwind vorteilhaft sein, nicht mit dem maximal möglichen Klappenausschlag zu landen. Der Anflug mit hängendem Tragflügel schattet die Klappen gegenüber dem Windeinfluss teilweise ab. Daher spricht viel für den Anflug mit hängender Fläche. Noch schwieriger als bei starkem Gegenwind ist es, in Böen und Turbulenzen die Flugparameter einigermaßen konstant zu halten.
aerokurier Ausgabe 11/2013