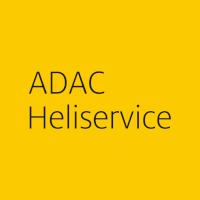Die Ampaire Eco Caravan ist eine Cessna Grand Caravan des US-Herstellers Textron, die mit einem hybridelektrischen Antrieb anstelle der 867 Wellen-PS (647 Kilowatt) starken PT6A-140-Wellenturbine ausgerüstet ist. Dabei können wahlweise der elektrische Antrieb, der Verbrennungsmotor oder beide Technologien gleichzeitig genutzt werden. Der Elektromotor soll das Flugzeug beim Start und im Steigflug bis zur Reiseflughöhe mit antreiben, danach übernimmt normalerweise das Kolbentriebwerk. Je nach den Missionsanforderungen des Betreibers kann der Elektromotor für den Reiseflug mitverwendet oder stattdessen zum Aufladen der Batterien eingesetzt werden. Die können zwar auch am Boden aufgeladen werden, eine Ladeinfrastruktur ist somit aber nicht zwingend notwendig.
Mit Testpilot Elliot Seguin am Steuer hob das Flugzeug um 7:49 Uhr Ortszeit vom Flugplatz Camarillo nördlich von Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien ab und stieg bei voller Leistung auf eine Höhe von 3500 Fuß. Anschließend drosselte der Pilot das Flugzeug auf eine Reiseflug-Einstellung, um die Belastung sowohl des Verbrennungsmotors als auch des Elektromotors zu verringern. Der Testpilot erprobte etwa 20 Minuten lang die verschiedenen Leistungseinstellungen des Flugzeugs und beobachtete Temperaturen und andere Sensormesswerte, bevor er mit niedriger Leistung zurück zum Flughafen flog, so Ampaire.
Motorentechnik aus Deutschland
Das Herzstück des hybridelektrischen Antriebs ist der Selbstzündungsmotor A03 des Herstellers RED Aircraft aus dem rheinland-pfälzischen Adenau. Der Zwölfzylinderdiesel leistet nach Herstellerangaben 410 kW und kommt in einer Parallelkonfiguration mit einem 160-kW-Elektromotor zum Einsatz. Die Nettoleistung des gesamten Antriebsstrangs wird somit voraussichtlich 570 kW (765 PS) betragen. Die Akkus für die Stromversorgung des Elektroantriebs stammen von Electric Power Systems (EPS) und sind im Cargopod der Grand Caravan auf der Rumpfunterseite untergebracht. Nach Angaben von EPS weisen die Akkus eine Energiedichte von 200 Wh/kg auf und überstehen mehr als 2000 Schnellladezyklen, bevor sie ersetzt werden müssen.
RED Aircraft verspricht für den Dieselmotor einen doppelt so hohen thermodynamischen Wirkunngsgrad wie den der in der Grand Caravan serienmäßig verbauten Pratt & Whitney-Propellerturbine. So muss für eine gegebene Distanz weniger Kraftstoff getankt werden, die maximal mögliche Zuladung bleibt somit trotz schwerer Akkus an Bord erhalten. Ampaire gibt die Betriebskosten der Eco Caravan je nach Mission als 25 bis 40 Prozent geringer als die der Turboprop-Caravan an.

Bis zu 70 Prozent weniger Sprit
Ampaire schätzt, dass weltweit rund 3000 Flugzeuge im Einsatz sind, die für eine Umrüstung auf den hybridelektrischen Antrieb in frage kämen. Die Eco Caravan soll eine Reichweite von über 1000 Nautischen Meilen haben. Dabei soll das Flugzeug auf kurzen Strecken 70 Prozent, auf längeren Strecken immer noch 50 Prozent weniger Kraftstoff verbrauchen als die Turboprop-Version.
Der Einbau des Modifizierungskits soll am Ampaire-Firmensitz am kalifornischen Fluplatz Hawthorne nahe Los Angeles und über ein Netz unabhängiger Wartungsbetriebe erfolgen. Der Hersteller beziffert die Kosten für das Triebwerk niedriger als die einer PT-6A-Propellerturbine.
Mit einer hybridelektrischen Cessna Skymaster als Testplattform hat Ampaire zuvor die Technologie der Eco Caravan-Antriebstechnik erprobt. Unter anderem hält die Push-Pull-Twin mit über 1000 Nautische Meilen auf dem Weg zur größten Luftfahrtveranstaltung der Welt, dem Airventure in Oshkosh, Wisconsin, den Rekord für den längsten Flug mit einem hybridelektrischen Antrieb.

Ampaire strebt die Zulassung der Eco Caravan bereits 2024 an. Möglich ist der knappe Zeitrahmen, weil das Unternehmen bei dem Projekt auf ein bestehendes Flugzeugmuster, die Cessna 208B Grand Caravan, zurückgreift. Der hybridelektrische Antrieb wird lediglich über ein Supplemental Type Certificate (STC) zertifiziert.
Die neunsitzige Grand Caravan ist nur das erste Flugzeug, mit dem Ampaire den Markt erobern will. Geplant ist außerdem eine elektrifizierte Version der de Havilland Twin Otter und eine komplette Neukonstruktion mit dem Projektnamen "Tailwind".