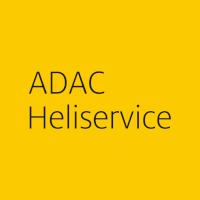Elisa, mit deiner Erfahrung von knapp 1000 Flugstunden könntest du wahrscheinlich jede Superorchidee fliegen. Was fasziniert dich an einer alten, tschechischen Blechdose wie dem Blaník?
Schau ihn dir doch an! Diese Silhouette, das Flugbild, das ist absolut einzigartig, so sieht kein anderes Segelflugzeug aus. Das Geräusch, das das Metall macht, wenn sich das Flugzeug in der Luft oder am Boden bewegt. Man steigt ein und hat immer noch nicht das Gefühl, in einem Segler zu sitzen, fühlt sich eher wie der Pilot einer B-25. Und dann noch die Vielseitigkeit des Blaník. Ob Anfängerschulung, Streckenflug, Akroprogramm – er kann irgendwie alles. Und schließlich das Landen auf den Punkt, wenn man die Fowlerklappe voll setzt. Der LET-13 ist ein richtiger Charakterflieger, den man einfach mögen muss.
Was ging dir durch den Kopf, als du vom Unfall in Ferlach gehört hast?
Wir waren allesamt sprachlos. Zunächst galt es, weitere Informationen zu bekommen und herauszufinden, was passiert war. Wir kamen aber überhaupt nicht auf die Idee, dass das Flugzeug strukturelle Schwächen haben könnte. Denn in unserem Verein, der Flugsportgruppe Grimming, die damals vier Blaníks in der Flotte hatte, gibt es zu diesem Typ eine Art Grundvertrauen, weil wir mit ihm viel machen und seine Grenzen auch wirklich ausreizen. Am Unfalltag herrschte in Ferlach zudem schwieriges Wetter mit Föhnwalzen, die Ursache hätte also auch darin liegen können. Umso mehr hat uns das Ergebnis der Unfalluntersuchung – ein Versagen des Tragflächenholms durch Ermüdungsrisse – und das Grounding durch die EASA geschockt.
Die Liebe deines Fliegerlebens war plötzlich im Prinzip ein Haufen Altmetall ...
Ich hatte in dem Moment tatsächlich das Vertrauen in das Flugzeug verloren. Und im Verein war schnell klar, dass wir den Blaník ohne irgendeine Modifikation – selbst wenn die EASA das Go dafür gegeben hätte – nicht wieder in die Luft bringen wollen. Uns war klar, wir fliegen nur, wenn es eine strukturelle Verstärkung gibt und wir dem Flugzeug wieder hundertprozentig vertrauen können. Nur eine Prüfung allein hätte uns einfach nicht ausgereicht.
War euch bewusst, dass der Unfall auch das endgültige Aus für den Blaník hätte bedeuten können?
Das war uns relativ schnell bewusst, zumal der Hersteller LET auf Nachfragen hin deutlich machte, dass man aufgrund des Alters des Typs und der Fokussierung auf andere Geschäftsfelder wenig Interesse hat, in der Sache aktiv zu werden. Damit stand fest: Wenn wir es nicht selber in die Hand nehmen, ist es vorbei.
Wie ging es weiter?
Nachdem ein paar Monate ins Land gegangen waren und die Blaníks am Boden standen, kamen mein bester Freund Kurt Tippl und ich zu dem Schluss, dass etwas passieren muss. Kurt ist Teamleader der „Blanix“ und liebt den Metallflieger genauso wie ich. Also beschlossen wir, etwas zu tun – ohne genau zu wissen, was. Aber der Blaník sollte wieder fliegen.
Stand euer Verein sofort hinter euch oder oder musstet ihr Überzeugungsarbeit leisten?
Da war sogar eine Menge Überzeugungsarbeit nötig! Unter meinen Kameraden hat es manchen gegeben, der meinte, wir sollen es lassen, der Blaník sei ein Museumsflugzeug und habe ausgedient. Es gab auch richtige Pessimisten, die nicht geglaubt haben, dass wir es schaffen können. Aber das war natürlich nur noch mehr Ansporn. In einem Punkt hatten die Skeptiker aber Recht: Wir wussten tatsächlich nicht, auf was wir uns da einließen.
Auf was habt ihr euch denn eingelassen?
Auf einen Weg mit vielen Höhen und Tiefen. Das wohl Wichtigste dabei war das Networking in der Fliegercommunity. Man überlegt, wen man wegen eines Problems ansprechen kann, und es gibt immer wieder einen, der einen kennt, der einen kennt. Man muss sich so lange durchfragen, bis man an die richtigen Leute gerät, die einem helfen können.
So seid ihr bei Marcus Basien und seiner Firma Aircraft Design & Certification gelandet ...
Genau. Nach vielen Absagen war er derjenige, der sich das Projekt zugetraut hat. Gleich im ersten Telefonat hat er uns versprochen, das Ganze mit uns durchzuziehen.
Kannte Basien den Blaník?
Nicht wirklich. Alles, was er wusste, stammt aus Erzählungen. Er hat vermutlich die Verzweiflung in unseren Stimmen gehört und deshalb zugesagt. Noch vor Basiens Zusage hatten wir unsere vier Blaníks zum Instandsetzungsbetrieb Falcon Aircraft nach Tschechien gebracht, ohne überhaupt zu wissen, wie es weitergeht. Marcus kam schließlich dorthin und hat sich die Flugzeuge angesehen.
Welchen Weg ging Basien, um das Problem zu lösen?
Zunächst stand für uns Recherchearbeit an, denn er brauchte technische Zeichnungen vom Blaník. Über den Hersteller war nur mehr wenig zu bekommen, und letztendlich hat Basien ein CAD-Modell des Flugzeugs entwickelt und in Computersimulationen die Belastung der neuralgischen Stellen mit allen Kräften und Kraftspitzen errechnet. Aus Daten der Unfalluntersuchung war klar, dass die Konstruktion dort versagt hatte, wo in die Aluminiumbänder der Tragflächenholme der Stahlkeil für die Bolzenaufnahme eingearbeitet war.
Wie konnte es zu dem Versagen der Konstruktion an dieser Stelle kommen?
Zusätzlich zu den Ermüdungsrissen im Holm gab es noch eine kritische Niet-in-Niet-Verbindung, die den Bruch wohl auch begünstigt hat. Unter anderem waren die Nieten, mit denen der Stahlkeil und die Aluminiumbänder zusammengefügt sind, aufgebohrt worden, um die Beplankungsbleche Niet-in-Niet aufsetzen zu können. Bei der Modifikation werden jetzt Bolzen verwendet, die eine besondere Ermüdungsbeständigkeit aufweisen.
Und aus all den Simulationen und Recherchen entstand dann ein kleines Stück Blech, das den Blaník wieder flügge machte.
Ganz genau. Als wir Anfang 2011 das erste Mal gesehen haben, wie klein die Modifikation letztendlich ausfällt, war uns klar, dass wir mit Basien genau den richtigen Ingenieur gefunden hatten. Mit der Zertifizierung des Umrüstkits durch die EASA hatte der Blaník wieder eine Chance.
Wie ging es mit den Blaníks deines Vereins weiter?
Die Ergebnisse der Wirbelstromprüfung, die wir kurz vor Weihnachten 2010 bekamen, waren ein Schock. Bei dreien der vier Flugzeuge waren die Holme bereits derart geschwächt, dass eine Modifizierung nicht möglich war. Da habe ich kurz ans Aufgeben gedacht. Und ich fühlte mich von dem Flieger, auf dem ich kurz zuvor meine Kunstflugausbildung gemacht hatte, irgendwie im Stich gelassen. Nur die OE-0758 konnte modifiziert werden, und das war dann auch der erste Blaník, der wieder flog.
Ihr hattet also plötzlich drei Flugzeuge weniger ...
Richtig. Und hier beginnt die Geschichte von Lady Violet. Während die OE-0758 modifiziert wurde, sind wir zum Zeitvertreib auf einen Kaffee zum Nachbarflugplatz gefahren. In der letzten Ecke der dunklen Halle habe ich die Silhouette eines Blaník gesehen. Unter viel Staub kam die weiß-violette Lackierung zum Vorschein, daher der Name. In der Diskussion mit dem Verein stellte sich heraus, dass der Flieger nur knapp 900 Stunden ohne Kunstflug hatte, frisch aus der Generalüberholung kam und seitdem nicht wieder geflogen war. Die Werte bei der Wirbelstromprüfung waren super, und schließlich haben wir das Flugzeug gekauft und modifiziert. Seitdem fliegt er bei uns in Aigen.
Mit einer Prosecco-Dusche habt ihr im April 2011 in Aigen die Auferstehung des Blanik gefeiert. Wie hast du das damals erlebt?
Es war ein unbeschreiblich emotionaler Moment! Kurt und mir sind Tränen über die Wangen gelaufen, und wir waren einfach nur froh, dass es uns gelungen ist, den Blaník zu retten.
Lady Violet ist ein Vereinsflieger, kommt irgendwann Elisas persönlicher Blaník?
Der kommt ganz bestimmt. Und der bekommt dann entweder eine mattschwarze Lackierung oder wird auf Hochglanz poliert. Da bin ich mir noch nicht so richtig sicher ...
aerokurier Ausgabe 08/2016