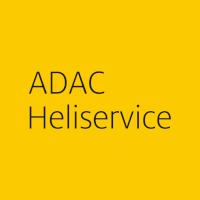Der Begriff „Arbeitsflugzeug“ bekommt nach den ersten paar Platzrunden mit der Pilatus Porter eine ganz neue Bedeutung. Die Muskelenergie, die beim Abfangen und Abheben notwendig ist, lässt schnell die Kräfte schwinden. Schon im Startlauf ist intensive Beinarbeit gefragt: Die Propellerebene liegt gut vier Meter vor dem Hauptfahrwerk, durch diesen großen Hebelarm verstärken sich die vom Propeller verursachten Momente enorm.
Vor dem Setzen der Startleistung empfiehlt es sich deshalb, zuerst die Trimmung voll rechts zu stellen und ordentlich das rechte Seitenruder zu treten. Danach wird der Power Lever vorsichtig, aber zügig auf einen Torque von 40 bis 42 PSI gesetzt, damit das Seitenruder sofort wirksam wird und das Ausbrechen nach links verhindert werden kann.
Kraftvoll packt die Turbine zu und beschleunigt die knapp zwei Tonnen schwere Porter in wenigen Metern auf Abhebegeschwindigkeit. Mit 2,8 t voll beladen wäre der Startlauf nur unwesentlich länger. Pilatus gibt witzigerweise auch keine Startrollstrecke im Flughandbuch an!
Während des Startlaufs gilt es unbedingt, das Spornrad auf dem Boden zu halten und in Dreipunktlage abzuheben. Hierfür verlangt die Porter ordentlich Zug am Knüppel. Sollte das Spornrad zu früh freikommen, macht sich sofort der durch den langen Hebelarm verstärkte P-Faktor bemerkbar, und die Maschine will unbarmherzig nach links ins Grüne.
Hier hilft nur noch ein kräftiger Tritt in das rechte Seitenruder und, wenn nötig, zusätzlich die Fußspitzenbremse.
Man merkt die Bremswirkung der riesigen Klappen

Nach dem Abheben sind gleich wieder die Oberarmmuskeln gefordert, denn in den ersten Momenten ist sofortiges Nachdrücken erforderlich, da die elektrische Höhenrudertrimmung relativ langsam arbeitet. In zirka 500 ft über Grund heißt es dann Fuel Pump „off“ und die Flaps einfahren.
Nach Erreichen der Platzrundenhöhe wird die Leistung dann auf 25 bis 30 PSI reduziert. Gemütliche 110 kts stellen sich ein. Der Fuel Flow liegt dann bei etwa 32 Gal/h, bei maximaler Startleistung können es bis zu 43 Gal/h sein.
Im Queranflug wird die Kraftstoffpumpe eingeschaltet und die Leistung auf 15 PSI reduziert. Bei 80 bis 90 kts werden die Klappen langsam auf Landestellung gefahren. Man merkt sofort die enorme Bremswirkung der riesigen Klappen, was beim Ausfahren gleichzeitiges Nachdrücken erforderlich macht, um die Anfluggeschwindigkeit nicht unter die geforderten 70 kts fallen zu lassen.
Im Endteil lässt sich der Anflugwinkel problemlos mit dem Power Lever regeln, wobei dank der enormen Bremswirkung der Klappen und des Propellers im Beta-Bereich auch sehr steile Anflüge kein Problem sind. Dabei sollte allerdings auf die Einhaltung der 70 kts geachtet werden, um noch genug Fahrtüberschuss für den Abfangbogen zu haben.
Für den Anfang ist es empfehlenswert, beide Hände zum Abfangen zu nehmen, um beim Aufsetzen auch wirklich das Spornrad am Boden zu haben. Während des Abfangbogens macht sich wieder der lange Hebelarm bemerkbar, und die Porter will mit aller Gewalt nach links. Wie bereits beim Startlauf hilft auch hier nur ein beherzter Tritt ins rechte Seitenruder, damit die Nase auf der Centerline bleibt.
Wie bei allen Spornradflugzeugen sollte ein Aufsetzen im Schiebezustand unbedingt vermieden werden, da sonst das Heck zum Ausbrechen neigt. Dank des stark dämpfenden Fahrwerks krallt sich die Porter förmlich an den Boden, auch ein zu hohes Abfangen wird klaglos vom Fahrwerk geschluckt. Wenn notwendig, lässt sich die Landerollstrecke zusätzlich mit Umkehrschub verkürzen. Die Benutzung des Umkehrschubes im Flug ist allerdings untersagt, da die starke Verzögerung und die Vibrationen die Flugzeugzelle zu sehr belasten würden!
Bei nicht korrektem Trim-Setting sind die Kräfte kaum zu beherrschen

Eine weitere Besonderheit der Porter ist die trimmbare Höhenflosse. Diese führt jedoch dazu, dass bei nicht korrektem Trim-Setting die enormen Höhenruderkräfte kaum zu beherrschen sind. Das hat in der Vergangenheit bereits zu einigen Unfällen geführt.
Mittlerweile sind die meisten Porter deshalb mit einer elektrischen Trimmung inklusive Warnsystem ausgestattet. Dieses erzeugt nach 20 Sekunden am Boden einen schrillen Warnton, sollte sich die Trimmung nicht im neutralen Bereich befinden.
Trotz ihres Alters gibt es bis heute nur wenige vergleichbare Muster, mit denen man mit so viel Zuladung von so kurzen Plätzen aus operieren kann. Die Porter wird bei Pilatus nach wie vor gebaut und ist dank stetiger Verbesserungen, wie zuletzt durch das Glascockpit, weiterhin gefragt und hat ihren Nischenmarkt gefunden.
Text: Christian von Wischetzki
PC-6: Der Weg in das Cockpit
Um eine Pilatus PC-6 als „Pilot in Command“ führen zu dürfen, schreiben die meisten Versicherungen eine Gesamtflugerfahrung von mindestens 250 Stunden und etwa 25 bis 50 Flugstunden nach Beendigung der Schulung unter Aufsicht (Supervision) vor.
Besonders umfangreiche Spornraderfahrung auf PS-starken Flugzeugen ist von Vorteil. Nach einer theoretischen Schulung von etwa zwei Tagen, die eine Unterweisung zu Triebwerk, Flugzeugkomponenten, Performance und Notverfahren beinhaltet, muss ein schriftlicher Test abgelegt werden. Ist dieser bestanden, erfolgt die Praxis. Sie umfasst fünf bis sieben Flugstunden und endet mit einem einstündigen Prüfungsflug.
In der folgenden „Supervision-Phase“ werden speziell für den Fallschirmsprungbetrieb die umfangreichen und anspruchsvollen Absetzverfahren trainiert.
Durch die überschaubare Anzahl Flugzeuge ist der Bedarf an PC-6-Piloten relativ gering. Ohne eine feste Tätigkeit bei einem PC-6-Operator, im Anschluss an den Erwerb der Klassenberechtigung, ist es wenig sinnvoll, die etwa 7000 Euro für das Rating zu investieren.
In Deutschland sind aktuell 16 PC-6 registriert, von denen neun auch dort betrieben werden.