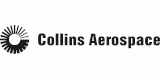Rissprüfung zerstörungsfreie Werkstoffprüfung
„Der Unfall ist darauf zurückzuführen, dass, ausgehend von einem Ermüdungsanriss, der Bruch einer Tragfläche erfolgte" – Sätze wie diese finden sich einige in den Untersuchungsberichten der BFU und anderer Flugunfallinstitutionen. Glücklicherweise enden die Ereignisketten, an deren Anfang eine unscheinbare Materialunregelmäßigkeit stand, nur selten in einer Katastrophe.
Risse in zahllosen Variationen dagegen sind alltäglicher Anblick in den Luftfahrttechnischen Betrieben. Ob das betroffene Bauteil sofort ausgetauscht oder repariert werden muss oder weiterverwendet werden kann, hängt von vielen Faktoren ab.
Klar ist: Die Aufdeckung verborgener Kleinstschäden ist von existenzieller Bedeutung für die Luftfahrt. Den Luftfahrttechnischen Betrieben steht dafür ein umfassendes Repertoire an Prüfverfahren zur Verfügung.
Alle die Testmethoden, bei denen das zu prüfende Material in seinen Eigenschaften nicht verändert wird, werden unter dem Begriff der „zerstörungsfreien Werkstoffprüfung" (ZfP) zusammengefasst.
Ganz oben auf der Liste der Verfahren steht unangefochten die gute alte Sichtprüfung. Sie gehört sowohl bei der Fertigung als auch bei der Instandhaltung zu den wichtigsten zerstörungsfreien Testverfahren.
Das geschulte Auge leistet Erstaunliches und ist, wie die Erfahrung zeigt, durch Technik nicht vollständig zu ersetzen.
Um haarfeinen Rissen auf die Spur zu kommen setzen Luftfahrttechnische Betriebe darüber hinaus das Farbeindringverfahren und die Magnetpulverprüfung ein. Die beiden Prüfmethoden machen sich unterschiedliche Prinzipien zunutze, haben aber doch Ähnlichkeiten. In beiden Fällen wird ein Prüfmittel auf die Oberfläche aufgetragen und das Ergebnis visuell ausgewertet.
Die einfachste Form des Farbeindringverfahrens ist dass sogenannte Rot-Weiß-Verfahren. Es ist sehr populär, weil universell einsetzbar und einfach in der Handhabung. Hier wird ein rotes Farbeindringmittel mit hoher Kriechfähigkeit, auch Penetrant genannt, aufgesprüht.
Das Prinzip, das hier zur Geltung kommt, ist die Kapillarwirkung der schadhaften Stellen, wenn sie zur Oberfläche offen sind. Nach der Einwirkzeit wird eine weiße Entwicklerflüssigkeit aufgetragen, die die rote Farbe gleichsam aus den Rissen herauszieht und diese somit sichtbar werden lässt.
Die Rot-Weiß-Methode liefert in bestimmten Bereichen, etwa am Fahrwerk, brauchbare Ergebnisse, stößt aber schnell an Grenzen. Ist die Oberfläche des Bauteils zum Beispiel sehr offenporig, ergibt sich schnell ein diffuses Bild. Generell muss die Auswertung zügig erfolgen, da sich die Rissanzeigen später durch „Ausbluten" verbreitern und überlagern.
Immerhin lassen sich bei richtiger Anwendung Risse mit einer Breite von einem Mikrometer nachweisen. Ein menschliches Haar ist, zum Vergleich, 60 bis 80 Mikrometer dick.
Für dieses Verfahren spricht, dass es kostengünstig ist und keine komplexen Apparaturen erfordert. Außerdem können praktisch alle technisch relevanten Materialien geprüft werden, auch Nichteisenmetalle, faserverstärkte Kunststoffe und sogar Glas und manche keramische Werkstoffe.
Klar ist aber auch, dass nur solche Fehlstellen aufgedeckt werden können, die bis zur Oberfläche reichen. Um innere Risse oder Einschlüsse zu entdecken, müssen andere Verfahren wie etwa Ultraschall- oder Wirbelstromprüfung angewandt werden.
Detailliertere Ergebnisse als die Rot-Weiß-Methode liefert das Magnetpulververfahren. Es erfordert allerdings mehr Vor- und Nachbereitungsaufwand und eine Magnetierungsgerät. Das kann ein mobiles Handgerät sein, typischerweise ist es aber eine stationäre Anlage.
In der Natur der Sache liegt es, dass nur solche Bauteile geprüft werden können, die magnetisierbar sind. Außerdem muss das zu prüfende Teil in der Regel ausgebaut werden. Ein typischer Kandidat ist eine Kurbelwelle.
Die perfekte Säuberung des Prüflings vor der Behandlung und erst recht danach ist bei diesem Verfahren oberstes Gebot. Ein Nachteil ist, dass das Bauteil anschließend wieder entmagnetisiert werden muss. Dies nicht nur, weil Bordinstrumente gestört werden könnten, sondern auch, weil sich sonst natürlich metallische Schmutzpartikel bevorzugt auf das Teil stürzen würden.
Das Prinzip, das man sich hier zunutze macht, kennt jeder aus dem Physikunterricht: Wird ein Gegenstand aus magnetisierbarem Material in ein Magnetfeld gesetzt, dann werden die Feldlinien in den Gegenstand hineingezogen. Innerhalb des Gegenstandes verlaufen die Feldlinien normalerweise gradlinig. Wenn es aber eine Störung in Form zum Beispiel eines Risses gibt, weicht ein Teil der Linien innerhalb des Materials aus. Ein anderer Teil tritt an der Oberfläche heraus. Es bildet sich der sogenannte Streufluss, der die Stelle zu überbrücken versucht, indem alle frei beweglichen Eisenteile anzieht.
Im LTB wird daher der Prüfling in die Prüfmaschine eingespannt und magnetisiert. Dann wird feinstes Eisen- oder Eisenoxidpulver trocken oder als Suspension aufgetragen, das sich blitzschnell an den Streuflussstellen sammelt.
Eine überaus detailreiche Anzeige entsteht durch den fluoreszierenden Farbstoff, der dem Eisenpulver beigemischt ist, und das UV-Licht.
Die Handhabung des Verfahrens erfordert spezielle Kenntnisse. So ist es beim Einsatz von Magnetpulversuspension von größter Wichtigkeit, die Anzeigefähigkeit des Prüfmittels ständig zu kontrollieren. Die Auswertung wiederum verlangt nach sehr viel Erfahrung.
„Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen", sagt Werner Helm, Inhaber eines LTBs am Stuttgarter Flughafen. „Man muss wissen, wo man nachsehen muss und mit welchen Mitteln." Viele der Rissprüfungen, mit denen es Helm und seine Mannschaft zu tun bekommen, sind Routineprüfungen, vorgeschrieben vom Hersteller oder angeordnet zum Beispiel durch eine LTA.
Spannend wird es bei den Verdachtsprüfungen, an deren Anfang eine Ahnung stand, „dass da was sein könnte." Und hier liefern die gängigen Methoden der Rissprüfungen schnelle und zumeist sehr präzise Resultate. Diese haben den praktischen Nebeneffekt, dass man mit den dokumentierten Schadensbildern dem Kunden gegenüber besser argumentieren kann.
Interessant für einen altgedienten Luftfahrttechniker wie Werner Helm ist immer wieder der Vergleich zwischen dem, was man sieht, und dem, was die technischen Mittel darüber hinaus offenbaren. „Man kann nichts ausschließen", hat er in seiner langjährigen Praxis gelernt. Daher weiß er auch, dass ein Gutteil der Problemstellen an den Flugzeugen nicht auf normale Alterungsprozesse oder Überbeanspruch zurückzuführen ist.
„30 Prozent der Risse", schätzt der LTB-Mann, „sind schon ab Werk vorhanden."