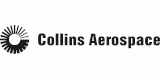Wo auch immer Günther und Uschi Kälberer mit ihrer Rosalie auftauchen, das Flugzeug ist stets umringt von interessierten Zuschauern. „Nach so einem Tag brauchst du ein ganzes Wochenende zum Polieren“, sagt Uschi, die dafür immer ein weiches Tuch und Aluminiumpolitur im Gepäck hat. Sie weiß um die Wirkung ihrer Ryan STA Special (STA steht für Sport Trainer Aerobatic, der Zusatz Special für das besondere Triebwerk). Rosalie ist ein ganz besonderes Flugzeug: sehr alt, sehr gepflegt und in jahrelanger Arbeit auch top restauriert. Die NC17360 der Kälberers gibt es mit dem Menasco-D4-B-Motor mit Turbolader nur ein einziges Mal auf der Welt – und ihr heimischer Hangarplatz ist in Mengen.
Die Geschichte dieses Flugzeugs ist speziell. Speziell, weil es 1938 Star des Hollywood-Films „Test Pilot“ mit Clark Gable und Myrna Low war; speziell, weil sein Erbauer T. Claude Ryan 1972 mit exakt diesem Flugzeug noch als 74-jähriger Pilot unterwegs war, und speziell auch, weil es fast 15 Jahre mit ausgesprochen zähen Verhandlungen gedauert hat, bis Günther Kälberer sein Traumflugzeug nach Deutschland holen konnte.
Als Kälberer, der schon immer ein Faible für alte und besondere Flugzeuge hatte, 1990 dienstlich in den USA weilte – damals war er Phantom-Fluglehrer bei der Bundeswehr –, kam er in Kontakt mit dem Besitzer der Ryan STA Special. Der Arzt, nach dessen Ehefrau der schöne, offene Tandem-Zweisitzer benannt ist, hatte jedoch bezüglich des Preises inakzeptable Vorstellungen. Als Alternative fand Kälberer eine ebenfalls von Claude Ryan konstruierte PT-22A mit Fünfzylinder-Kinner-Sternmotor und poliertem Aluminiumrumpf, die er nach seiner USA-Verwendung nach Wittmund holte und von dort aus viele Jahre flog. Nach der Pensionierung zog es die Kälberers nach Süddeutschland. 2002 verkauften sie die Ryan PT-22A an Freunde aus der Schweiz.
Nun suchte Günther Kälberer nach neuen Herausforderungen. Sein Interesse weckte die Do 28 A1, die einst von Franz Josef Strauß pilotiert worden war. „Da war aber der Rest meiner Familie (bestehend aus Ehefrau Uschi) nicht einverstanden“, erzählt er beim Kaffee im Hangar in Mengen. Dort haben auch andere fliegerische Schätze eine Heimat gefunden. Neben den Flugzeugen von Uschi und Günther sind dies die Oldies von Walter Klocker und Alois Bader – eine Kinner Sportster (1934), eine Morane Saulnier MS-317 (1938), eine Travel Air 4000 (1929) und eine Bellanca Cruisair Senior (1946). Gemeinsam sind die vier Piloten die „Antique Aeroflyers“.
Uschi Kälberer legte angesichts der kaum wirtschaftlich zu betreibenden Dornier-Zweimot ihr Veto ein. Inzwischen war sie – selbst Pilotin – auch Oldtimer-Enthusiastin geworden, aber sie wollte „was Glänzendes, Offenes“, ergänzt sie und zwinkert ihrem Mann zu. Und da kam die Ryan STA Special aus Florida wieder ins Spiel: „wunderschön, schlank, stimmig in allen Proportionen, einzigartig, geschichtsträchtig, aber mit realitätsferner Preisvorstellung ihres Besitzers.“
Die mexikanische Luftwaffe hatte 1937 fünf Ryan STA Special für die Ausbildung bestellt. Die NC17360 ist die einzige Überlebende. Das Metallflugzeug, übrigens das erste weltweit, das in Semi-Monocoque-Bauweise hergestellt wurde, stand auf einem Sockel bei der Air Academy in Mexiko, von wo es mit viel Verhandlungsgeschick zurück in die USA geholt und wieder flugfähig gemacht wurde. Nach mehreren Besitzerwechseln landete es bei Dr. Sherman in Florida. Der Ryan-Besitzer war inzwischen dank seines familiären Einflusses kompromissbereiter. Nach fast einem Jahr der Gespräche, der Abbrüche und neuen Verhandlungen wurden sich beide Männer schließlich einig. Es war der 31. Dezember 2004, als Günther Kälberer das Flugzeug übernahm und vom privaten Landestrip des Arztes Richtung Stennis flog. Uschi folgte mit dem Auto.
Originalteile verbaut
Die Ernüchterung kam schon während des ersten Legs: Das Flugzeug verlor massiv an Öl. Motoröl setzte sich auf die Scheiben, den Rumpf und die Streben. Kälberer flog gerade über die Sümpfe Floridas, unten lauerten die Alligatoren, und Öldruck war kaum noch vorhanden. Auf dem nächstmöglichen Strip landete er. Es war nur noch ein Liter Öl im Tank. Er und der hilfsbereite Betreiber des kleinen Airports identifizierten ein defektes Druckventil und ein falsch angeschlossenes Öl-Shut-off-Ventil. Nach der Reparatur konnte es weitergehen. Aber die Reise mit Rosalie wäre zwei Tage später bei einer Zwischenlandung auf einem kleinen Platz beinahe zu Ende gewesen: „Bei fünf Knoten Rückenwind – ich musste mich in die Platzrunde einreihen – war nach dem Aufsetzen Rodeo angesagt. Trotz mehr als 2600 Stunden Spornraderfahrung auf vielen Typen war ein tiefer Griff in die Trickkiste das letzte Mittel, um Negativschlagzeilen in der Lokalpresse zu verhindern. Erst viel später sollte ich lernen, warum sich die alte Dame derart widerspenstig verhalten hat. Einer der Vorbesitzer hatte das nicht angelenkte Spornrad modifiziert und dabei unbeabsichtigt die Fahrwerksgeometrie derart verändert, dass jeder Ausschlag am Spornrad zwangsläufig zu einem noch größeren in dieselbe Richtung führte – in Kombination mit mechanischen Seilzug-Trommelbremsen, die auf beide Räder gleichzeitig wirken, keine gute Eigenschaft!“ In Stennis wurde das Flugzeug zerlegt und in den Container gepackt. Sein Ziel: Mengen. Sechs Wochen später erfolgte die Auslieferung, ohne äußere Beschädigungen. „Hätte ich damals mehr vom inneren Zustand gewusst, hätte ich es wahrscheinlich nicht mal zur Tankstelle gerollt, geschweige denn über die Everglades geflogen“, erzählt Kälberer.
Aus der für sechs bis acht Monate geplanten Restaurierung wurden mehrere Jahre. Die Arbeiten zogen sich dahin. Während andere Piloten mit ihren schicken Oldies fliegen konnten, arbeiteten Uschi, Günther und ihre Helferfreunde auch im Winter bei minus acht Grad in einer unbeheizten Halle. Und immer wieder staunten sie über das, was im Inneren ihres Flugzeugs zum Vorschein kam: Klempner-Fittinge im Motorraum, Baumarktbolzen im Fahrwerksbereich, Besenstielholz im Sporn, wo eigentlich solides Stahlrohr hätte verbaut sein müssen, und Schweißnähte, die den Namen nicht wert waren.
Im vierten Frühjahr konnten endlich die ersten Teile zusammengebaut werden, die Flügel wurden montiert ,und bei Eichelsdörfer in Bamberg erfolgten Bespannung und Lackarbeiten. Ein an der Dreh-, Hobel- und Fräsmaschine virtuoser Freund baute eine Spornradverriegelung für Start und Landung, Ein anderer Freund nahm sich nach Ryan-Originalvorlagen der vier Auspuffkrümmer an.
Trotzdem kamen die Arbeiten erneut ins Stocken, als Günther Kälberer durch Freunde seines US-Netzwerks von der geplanten Auflösung eines Privatmuseums in den USA erfuhr. Eine Pilotenwitwe wollte sich von einer Curtiss Robin J-1, Baujahr 1929, trennen. Welch eine Chance! Das Flugzeug wechselte nach Mengen, und die Kälberers reihten es nach der Restaurierung, die weitaus weniger aufwendig verlief als die der Ryan, in die Oldtimer-Sammlung ein.
Nun verliefen auch die weiteren Arbeiten an der Ryan STA zügig. Im Cockpit wurden weitgehend Originalinstrumente verbaut. Dabei traf man auf Spezialisten, die alte Instrumente reparieren konnten. Während die Rumpfbeplankung weitgehend original erhalten blieb, gab es einen Kompromiss bei den Bremsen. „Die Original-Seilzugbremsen sind für heutige feste Landebahnen nicht gut geeignet. Deshalb haben wir hydraulische Scheibenbremsen eingebaut. Aufgrund der Radverkleidung werden sie von außen allerdings kaum wahrgenommen und stören den Gesamteindruck nicht“, sagt Kälberer. Das fand auch die OUV, als sie sowohl die Ryan als auch die Curtiss im Jahr 2008 mit Preisen auszeichnete.
Im Flug ist die alte kalifornische Dame überraschend wendig und agil, „eine sehr gelungene Konstruktion“, wie Kälberer bestätigt. Von vielen Fachleuten wird sie auch als eines der schönsten Flugzeuge bezeichnet, die je gebaut wurden.
Dem kann ihr Besitzer uneingeschränkt zustimmen. „Obgleich das vordere Cockpit schon reichlich eng ist. Das hintere Cockpit bietet schon mehr Platz. Trotzdem muss man sich das Flugzeug anziehen.“ Und lachend fügt er hinzu: „Irgendwann wird man mich mit dem Kran hineinheben müssen. Aber nie würde ich die Ryan hergeben. Sie wird sicher das letzte Flugzeug sein, das ich fliegen werde.“
Selbst wenn Rosalie „nur“ im Hangar steht, zieht sie viel Aufmerksamkeit auf sich. Die Antique Aeroflyers bekommen häufig Besuch aus ganz Europa. Und ein Blick in ihr Gästebuch dokumentiert begeisterte Einträge auch aus den USA, Israel, Südafrika, Japan, Malaysia oder Neuseeland.
Technische Daten
Ryan STA Special
Hersteller: Ryan Aeronautical Corporation, San Diego, Kalifornien, USA
Sitzplätze: 2 (Tandemanordnung)
Bauweise: Metall/Semi-Monocoque
Verwendung: Sportflugzeug/Trainer
Antrieb
Hersteller: Menasco D4-B
Leistung: 110 kW/150 PS
Abmessungen
Spannweite: 9,40 m
Höhe: 2,79 m
Länge: 6,53 m
Massen und Mengen
Leermasse: 490 kg
maximale Abflugmasse: 720 kg
Leistungen
maximale Geschwindigkeit: 203 km/h
Reichweite: 589 km
Dienstgipfelhöhe: 17 200 ft
Steigrate: 800 ft/min
Zur Person: T.Claude Ryan
Flugzeugentwickler, Luftfahrtingenieur, Pilot; geboren am 3.1.1898 in Parsons, Kansas, gestorben am 11.9.1982 in San Diego. Ryan gründete 1925 den ersten ganzjährigen Passagiertransport der USA zwischen San Diego und Los Angeles. Zum Einsatz kam der einmotorige Doppeldecker Davis-Douglas Cloudster.
Ryans eigener Entwurf hieß dann zwei Jahre später Ryan NYP (die Buchstaben standen für die Mission New York – Paris). Am 28. April 1927 brachte er den Schulterdecker aus Stahlrohr und Holz zum Erstflug. Weltbekannt wurde er unter dem Namen „Spirit of St. Louis“, als Charles Lindbergh mit ihm im Mai 1927 nonstop den Atlantik überquerte. 1932 gründete Ryan die Ryan Aeronautical Corporation in San Diego und entwickelte sein Meisterstück: die Ryan ST. Der Metall-Zweisitzer flog am 8. Juni 1934 zum ersten Mal. Insgesamt wurden 1568 Maschinen in verschiedenen Varianten als Sportflugzeug und für die zivile wie militärische Schulung gebaut. 1969 verkaufte Ryan seine Firma an die Teledyne Corporation.
aerokurier Ausgabe 09/2015