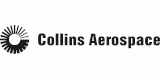Am 7. Oktober 1963 rollte ein gut aussehender, leichter Zweistrahler an der Start, der Learjet 23, Urahn einer höchst erfolgreichen Business-Jet-Familie. Auch wenn Bombardier das Datum heute aus Eigeninteresse feiert: Der Erstflug des Learjet 23 bedeutet ohne Zweifel einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte der Luftfahrt insgesamt. Er verkörperte bei seinem Erscheinen ein neuartiges Flugzeugkonzept, das einen neuen Markt geöffnet hat.
Die Wurzeln des Learjet 23 liegen in der Schweiz. Dort hatte William (Bill) Powell Lear die Swiss American Aviation Company gegründet. Der luftfahrtbegeisterte und innovationsfreudige Unternehmer stellte ein Team aus Schweizer und US-amerikanischen Ingenieuren zusammen und ließ sie ein neuartiges Strahlflugzeug speziell für Geschäftsreiseflüge zeichnen. Wichtige Designideen übernahmen sie von dem Schweizer Kampfflugzeugprojekt P-16. Noch vor dem Erstflug verlegte Lear im Sommer 1962 die Entwicklungsarbeit nach Wichita im Bundesstaat Kansas, wo die Learjet-Produktlinie noch heute ihren Hauptsitz hat, auch wenn sie mittlerweile zu dem kanadischen Bombardier-Konzern gehört.
Bill Lears Ingenieure hatten den für sieben Insassen konzipierten Zweistrahler mit knapp elf Metern Spannweite auf Leichtbau getrimmt und ihm einige interessante Neuerungen mit auf den Weg gegeben, die charakteristisch für alle künftigen Learjets werden sollten: zum Beispiel die zweiteilige, nach außen öffnende „Clamshell"-Tür und die weit herumgezogenen Cockpitfenster. Aus Sicherheitsgründen besaß der Learjet 23 ein zweifaches elektrisches System und eine separate Treibstoffzufuhr für jedes Triebwerk.
Erst spät in der Entwurfsphase hatte das neue Muster das T-Leitwerk anstelle des zunächst geplanten Kreuzleitwerks erhalten, was nicht unwesentlich zu der aufsehenerregenden Optik beitrug. Aufsehen erregten auch, wie Bill Lear sich das vorgestellt hatte, die Leistungsdaten. Die Serienflugzeuge erzielten mit ihren zwei General-Electric-Triebwerken eine Höchstgeschwindigkeit von fast 500 Knoten und eine Reisegeschwindigkeit von 450 Knoten.
Im Juli 1964 erhielt der Learjet 23 die FAA-Zulassung, und es dauerte nicht lange, und er machte durch Rekorde auf sich aufmerksam. Am 21. Mai 1965 zum Beispiel schrieb sich der Zweistrahler mit dem „dawn-to-dusk"-Flug in das Goldene Buch der Luftfahrt ein: Er flog in 10 Stunden 21 Minuten von Los Angeles nach New York und zurück. Einige Monate später stellte ein Learjet 23 einen Steigflugrekord auf: Mit sieben Personen an Bord spurtete er in 7 Minuten 21 Sekunden auf 40000 Fuß Höhe. Mit seinem Masse-Leistungs-Verhältnis von 1:2,2 konnte der Learjet den Überschalljäger F-100 im Steigflug hinter sich lassen.
Prominente Learjet-Käufer wie Frank Sinatra und Danny Kaye taten ein Übriges, um dem schnittigen Luftfahrzeug das Image eines schillernden Statussymbols zu verpassen.
Doch die kampfflugzeugähnlichen Flugeigenschaften hatten auch ihre Schattenseite: Die Unfallrate war anfangs hoch. Innerhalb von drei Jahren verunglückten 23 Flugzeuge. Angesichts von 104 gebauten Flugzeugen war dies eine sehr beunruhigende Zahl.
Die Lear Jet Corporation, wie die Firma mittlerweile hieß, reagierte darauf mit dem überarbeiteten Modell Learjet 24, das im Februar 1966 erstmals flog. Der bis heute andauernde Erfolg der Business-Jet-Familie namens Learjet nahm eigentlich hier seinen Anfang, denn das neue Modell wurde, anders als noch der Learjet 23, nach FAR Part 25, also den Anforderungen für Verkehrsflugzeuge, zugelassen.
Es war der erste Business Jet überhaupt, der entsprechend diesen Bestimmungen die Zulassung erhielt, und der erste, der später (1977) für eine Höhe von 51000 Fuß zugelassen wurde.
Nach dem Learjet 24 kamen in den Folgejahren weitere Modelle auf den Markt, und aus dem Learjet wurde eine Erfolgsgeschichte. Bereits 1975 verließ der 500. Learjet die Produktion, fünf Jahre später war Nummer 1000 an der Reihe.
Learjet unter Bombardier-Regie

1990 erwarb der kanadische Bombardier-Konzern das Learjet-Programm für 75 Millionen Dollar. Der kanadische Konzern beschäftigte sich bis zu diesem Zeitpunkt hauptsächlich mit Eisenbahntechnik und Schneemobilen. Bombardier wollte allerdings auch zu einer Größe im Flugzeuggeschäft werden; einige Jahre zuvor hatte der Konzern den Flugzeughersteller Canadair und damit auch das „Challenger“-Programm übernommen. Die Learjet-Reihe war somit eine ideale Ergänzung zu dem großen Business Jet, der seine Entstehung wiederum Bill Lear verdankte.
Der erste Learjet, der unter Bombardier-Regie seinen Erstflug absolvierte, ist zugleich eins der wichtigsten Modelle in der Programmgeschichte: der Learjet 60. Es ist das größte Modell der Reihe und wird diesen Rang erst mit der Zulassung des Learjet 85 verlieren. Mit dem Learjet 60 hielten erstmals üppig dimensionierte Pratt & Whitney-Turbofans Einzug in die Learjet-Familie. Schnell erwarb sich der Großraum-Business-Jet einen Ruf als heißes Fluggerät und knüpfte damit an das Image des legendären Learjet 24 an. Die aktuelle Version 60XR ist seit Ende 2006 zugelassen.
Mit dem neuen Learjet 85 schlägt Bombardier in mehrfacher Hinsicht ein neues Kapitel auf. Es ist der größte und schnellste Learjet und zugleich der erste, der aus Verbundwerkstoff gebaut wird. Bombardier hatte das Konzept 2007 vorgestellt, verbunden mit dem Ziel, die größte und komfortabelste Kabine im „Midsize“-Bereich anzubieten. Die acht bis zehn Passagiere werden dort Unterhaltungselektronik und Ausstattung vom Feinsten vorfinden. Mit seinen PW307B-Triebwerken von Pratt & Whitney Canada soll der Learjet 85 eine maximale Reisegeschwindigkeit von 470 KTAS erreichen und eine Reichweite von 3000 NM.
Neu im Programm sind auch die beiden kleinen Learjet-Modelle 70 und 75. Bombardier hat sie auf der EBACE 2012 präsentiert. Sie werden die Modelle 40XR und 45XR ablösen. Bombardier verspricht mehr Schub, bessere Start- und Steigleistungen, weniger Verbrauch und niedrigere Betriebskosten. Beide haben eine Reichweite von gut 2000 NM. Darüber hinaus besitzen sie eine überarbeitete Kabine, das neue Vision Flight Deck und modernisierte Triebwerke. Verkaufspreis: 11,1 beziehungsweise 13,5 Millionen Dollar. Das Kabinendesign orientiert sich an demjenigen des Learjet 85.
Das Kabinenmanagementsystem kann auch – dem Zeitgeist entsprechend – per iPad bedient werden. Ob Bill Lear das gut gefunden hätte? Zuzutrauen wäre es ihm, schließlich war er seiner Zeit, was das technisch Machbare angeht, gerne voraus.
aerokurier Ausgabe 10/2012